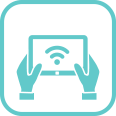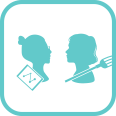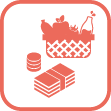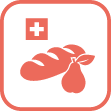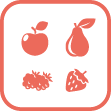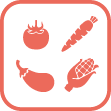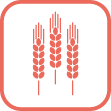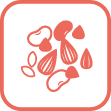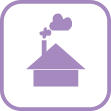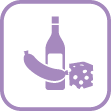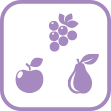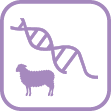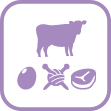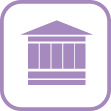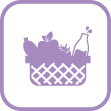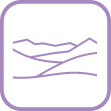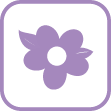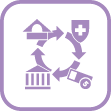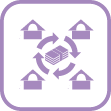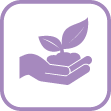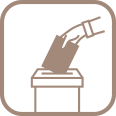Die Schweizer Landwirtschaft intensiviert sich ökologisch
Die Schweizer Landwirtschaft hat sich in den letzten 35 Jahren stark verändert. Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat abgenommen, während der Anteil an besonders ökologisch bewirtschafteten Flächen zugenommen hat. Trotzdem bleibt die Produktion konstant. Die Umwelt ist trotz Verbesserungen noch zu stark belastet.

Quelle: Fotalia, Adobe Stock und BLW
Das Produktionspotenzial eines Standorts optimal nutzen, ohne dabei die Tragfähigkeit der Ökosysteme zu überschreiten – das verstehen wir als standortangepasste Landwirtschaft. Für die Schweiz ist dies Ziel und Herausforderung zugleich. Dieser Artikel beleuchtet, wie sich die Produktion und damit verbunden die Auswirkungen auf die Umwelt in den letzten 35 Jahren entwickelt haben.
Da gibt es auf der einen Seite die normal-intensive landwirtschaftliche Produktion nach guter landwirtschaftlicher Praxis, die den Ökologischen Leistungsnachweis erbringt und einen Grossteil unserer Nahrungsmittel produziert. Auf der anderen Seite gibt es die Biodiversitätsförderflächen und andere besonders ökologisch bewirtschaftete Flächen, bei denen die natürlichen Lebensgrundlagen gezielt gefördert respektive geschont werden. Auch diese Flächen leisten einen grossen Beitrag zur Produktion, indem sie zur langfristigen Sicherung der Produktionsgrundlagen beitragen.
Leichte Abnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche
Während die landwirtschaftliche Nutzfläche hauptsächlich aufgrund des Siedlungswachstums in der Schweiz leicht abgenommen hat, nahm der Anteil an extensiv bewirtschafteten Flächen seit dem Jahr 2000 konstant zu. Die untenstehende Abbildung zeigt auf, für welchen Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche Direktzahlungen für die Biodiversitätsförderung oder den umweltschonenden Pflanzenschutz ausgerichtet wurden.
Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Hektaren
Gesunkene Tierzahlen in den 90er-Jahren
Auch die Anzahl gehaltener Nutztiere hat in der Schweiz über die letzten 35 Jahre abgenommen, wobei der Rückgang insbesondere in den 1990er-Jahren stattfand und die Zahlen seither etwa stabil bleiben.
Entwicklung der Nutztierbestände in Grossvieheinheiten
Die Entwicklung der Nutztierbestände wird dabei mithilfe von Grossvieheinheiten (GVE) dargestellt, welche die Zusammenfassung unterschiedlicher Tierarten erlauben. Eine Grossvieheinheit entspricht dabei einer Milchkuh. Diese Definition in der Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe blieb gleich, obwohl sich die Leistung der Nutztiere in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt hat. So hat zum Beispiel die durchschnittliche Milchmenge einer Milchkuh und damit auch ihre Nährstoffausscheidungen über denselben Zeitraum stark zugenommen.
Entwicklung der Anzahl Milchkühe, deren Milchleistung und -produktion
Dies erklärt die Tatsache, dass die Milchproduktion seit 1990 trotz weniger Milchkühen zwar schwankend, aber in der Tendenz gleichbleibend war (Agristat (2024), Milchstatistik der Schweiz 2023).
Stabile landwirtschaftliche Produktion
Wie die untenstehende Abbildung zeigt, schwankt das Ertragsniveau der gesamten Schweizer Landwirtschaft ausgedrückt in Gigajoules Nahrungsenergie zwischen 1994 und 2022 von Jahr zu Jahr. Es ist kein eindeutiger Trend feststellbar. Die landwirtschaftliche Produktion befindet sich somit auf einem vergleichbaren Niveau wie 1990. Und dies trotz einer deutlichen Abnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Anzahl gehaltener GVE.
Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion
Umweltleistungen verbessert, Ziele noch nicht vollständig erreicht
Obwohl sich die Umweltleistungen der Schweizer Landwirtschaft auch dank gezielter Förderung deutlich erhöht haben, werden die Umweltziele Landwirtschaft nicht in allen Bereichen erreicht. Dies zeigen das Agrarumweltmonitoring und die Daten, Indikatoren und Karten zur Entwicklung des Umweltzustands des Bundesamts für Umwelt (BAFU). Es besteht weiterhin Bedarf für Verbesserungen.
Steigerung der Produktion und Reduktion der Umweltbelastung
Es fand also über 35 Jahre betrachtet gleichzeitig auf einem Teil der landwirtschaftlichen Nutzflächen eine Intensivierung der Produktion statt, während der andere Teil mehr mit besonders ökologischen und damit auch extensiveren Bewirtschaftungsmethoden bewirtschaftet wird. Diese Entwicklung ging einher mit einer Verbesserung der Umweltleistungen und bedeutet, dass die Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion in der Schweiz insgesamt gesteigert werden konnte.
Diese ökologische Intensivierung soll weitergehen. Die landwirtschaftliche Produktion soll gesteigert werden, um dem Selbstversorgungsgrad bei steigender Bevölkerung zu verbessern. Eine weitere Steigerung der Effizienz ist nötig. Dabei sind die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und die Tragfähigkeit der Ökosysteme soll nicht mehr überschritten werden. So soll das Produktionspotenzial langfristig gesichert werden.
Standortangepasste Produktion birgt Potenzial
Das Richtige tun am richtigen Ort: Darin liegt ein grosses Potenzial. Es gilt das Produktionspotenzial an einem Standort optimal zu nutzen für die Nahrungsmittelproduktion und dabei Rücksicht zu nehmen auf die Sensibilitäten am Standort. Kulturwahl und Bewirtschaftungsmassnahmen sind hierbei entscheidend. Wo es zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für den Eintrag von Stoffen in das Grundwasser gibt und Trinkwasser gewonnen wird, sind andere Massnahmen angezeigt als an Standorten mit besonders sensiblen Ökosystemen und zu hohen Ammoniakemissionen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Standortangepasste Landwirtschaft bedeutet, nicht überall das Gleiche zu tun. Die Zusammenhänge sind komplex und für eine Entwicklung in die richtige Richtung braucht es gute fachliche Grundlagen. Daran arbeiten das BLW und Agroscope.
Mein Agrarbericht
Auswahl:
Stellen Sie sich Ihren eigenen Agrarbericht zusammen. Eine Übersicht aller Artikel finden Sie unter «Service».